Das Buch wurde mir freundlicherweise vom Kein & Aber Verlag zur Verfügung gestellt.
Yukio Mishima als Mensch und Autor hinterließ bei mir prägenden Eindruck, bevor ich je ein Buch von ihm gelesen hatte. In meinem ersten Kurs zu japanischer Literatur während des Studiums stellte ein Kommilitone „Bekenntnisse einer Maske“ vor. Mit Wort- und Bildgewalt zog der Vortrag uns alle in seinen Bann. Über diesen Mann, dessen sexuellen Begierden basierend auf Tod und Leiden sein Leben und Werk maßgeblich beeinflussten. Den Mann, der eine private Miliz gründete und am 25. November 1970 nach einem gescheiterten Putschversuch als letzter in Japan offiziell seppuku beging.
„Bekenntnisse einer Maske“ war Mishimas zweiter Roman und bietet über die an ihn selbst angelehnte Hauptfigur Einblicke in die Gedankenwelt seines jungen Ichs. Bei Kein & Aber erschien 2018 zum ersten Mal eine deutsche Übersetzung direkt aus dem Japanischen. Für mich ein guter Anlass das Buch endlich selbst zu lesen, nachdem mir viele Anklänge darauf in „Die Toten“ von Christian Kracht wieder begegnet waren.
„Bekenntnisse einer Maske“ von Yukio Mishima
Kochan ist der Ich-Erzähler dieses Romans. Er wächst als schwächlicher, immerzu kränkelnder Junge in den letzten Jahren des II. Weltkriegs auf und rechnet selbst nicht damit, älter als 30 zu werden.
Schnell wird sowohl ihm als auch dem Leser klar: Kochan ist ein wenig anders als seine Mitschüler. Seine erwachenden sexuellen Begierden beziehen sich nicht nur auf Mitschüler des eigenen Geschlechts, vor allem sind sie verbunden mit Schweiß, Blut und Tod. Eine besondere Rolle spielt dabei ein Bildnis des Heiligen Sebastian, das den schönen Jüngling von Pfeilen durchbohrt, sterbend darstellt. (spätestens bei der Erwähnung dieses Bildes ist klar, dass die Parallelen in Christian Krachts „Die Toten“ zu „Bekentnisse einer Maske“ als klare Hommage an Mishima zu verstehen sind)
Seine eigenen wachsenden Achselhaare werden zum Ausgangspunkt für Selbstbefriedigung, ein älterer, muskulöser Schulkamerad wird zum Objekt der Begierde und sexuell idealisiert.
Kochan geht durch diese ohnehin schon genug verwirrende Zeit der Pubertät allein, ohne Führung und Ansprechpartner. Für sich selbst kommt er zu dem Entschluss, dass seine Begierden falsch und jene der anderen in seinem Alter nachahmenswert sind. Die Maske, die dem Buch ihren Titel gibt, beginnt sich zu bilden und Kochan zu schützen.
Als er bei seinem Versuch, normal zu sein, soweit geht, dass er eine Beziehung mit einer Frau eingeht, muss er feststellen, dass seine Maske ihn vermeintlich schützt, aber nicht davor feit, andere zu verletzen.
Der erste Satz
„Lange Zeit habe ich behauptet, ich könnte mich an meine Geburt erinnern.“ (Mishima, S. 7, Kein & Aber, 2018)
Meine Meinung
Nachdem ich vor der Lektüre mit Mishimas Leben und Selbstdarstellung vertraut war, kam ich nicht umhin den Roman mit einer gewissen Sensationslust zu lesen. Handelt es sich auch um ein fiktionales Werk, floss dennoch viel von Mishimas eigenen Erfahrungen in die Geschichte mit ein. Und meine Neugierde war groß, was einen Jungen geprägt haben muss, der sich später selbst als Gesamtkunstwerk versteht, seinen Körper durch gezielten Muskelaufbau nach seinen Vorstellungen formte und seinen Freitod jahrelang im Voraus plante. Was hatte es mit dem Bildnis des Heiligen Sebastian auf sich, dass Mishima so beeindruckte, dass er selbst als dieser posierte?
„Bekenntnisse einer Maske“ beschreibt sezierend genau, was in Kochan vorgeht und wie er seine Welt wahrnimmt. Beindruckend nüchtern analysiert er dabei größtenteils seine Handlungen und Gedanken, wertet nicht selbst, sondern zeigt, dass Kochan durch äußere Einflüsse zum Entschluss kommt, dass seine Begierden und Wünsche falsch sind. So bezeichnet er zum Beispiel Selbstbefriedigung als „schlechte Angewohnheit“, sein jugendliches Ich ringt mit dem Zwiespalt körperlicher Bedürfnisse und seinem Verstand, der diese als falsch, schlecht und unangebracht kategorisiert hat.
Es ist kein hoffnungsvoller Roman, der am Ende ein glückliches Happy End parat hält. Vielmehr zeigt er die Selbstverleugnung des Protagonisten und den Schmerz, der ihm und seinen Mitmenschen dadurch entsteht. Die Sehnsucht nach einem „normal“, dass aus den Vorstellungen und Erwartungen anderer heraus entsteht, macht sein eigenes Glück unmöglich.
Sprachlich bin ich nicht der größte Mishima-Fan. Sein Roman ist voller Metaphern, die bei mir keinen Anklang finden. Stattdessen mag ich seinen Mut, sich mit unbequemen Themen auseinander zu setzen, vor allem, was die inneren Vorgänge der menschlichen Psyche angeht (siehe mein Hinweis auf seinen Roman „Der Goldene Pavillon“). Und für jeden, der sich für moderne, japanische Literatur interessiert, ist Mishima sowieso ein Muss.
Weiterführende Links
Für später pinnen
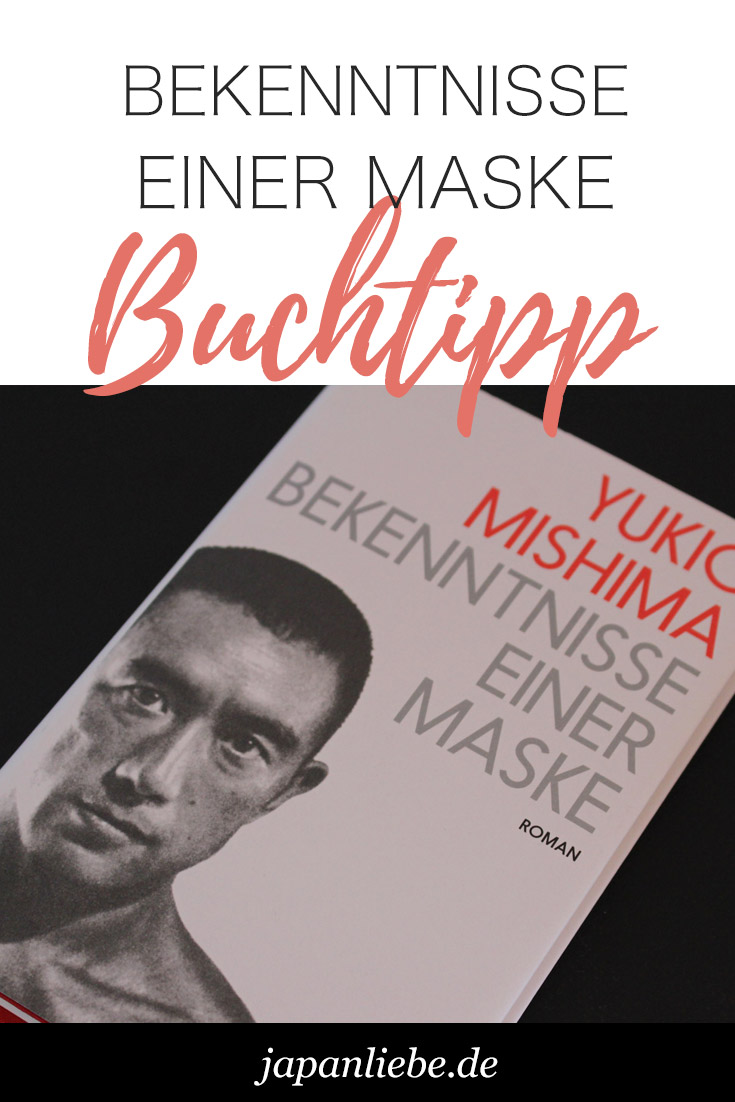 |
 |
*Partner-Link. Solltest du dich zu einem Kauf entscheiden, werde ich mit einer kleinen Summe beteiligt und bedanke mich recht ♥-lich. Dir entstehen dadurch keine weiteren Kosten.
PS: Wenn du täglich ein Stück Japan in deinen Social-Media-Feeds und dich mit anderen Japan-Fans austauschen möchtest, folge mir auf Facebook, Instagram, Twitter und Pinterest.
Noch mehr Neuigkeiten, Infos, Lustiges und Skurriles gibt es jeden Montag im Japanliebe Newsletter. Trag dich gleich ein und lerne Japan mit mir kennen.

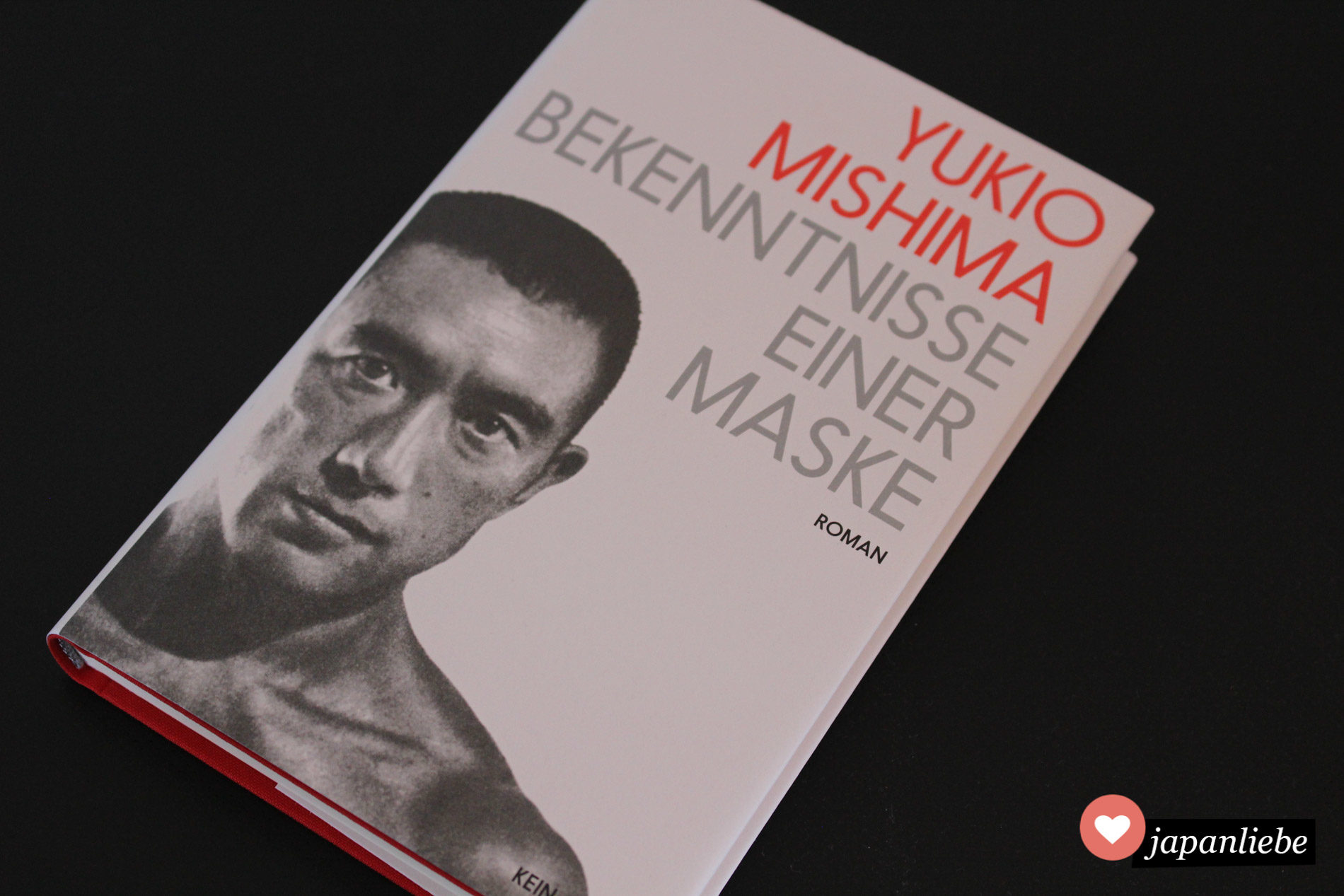
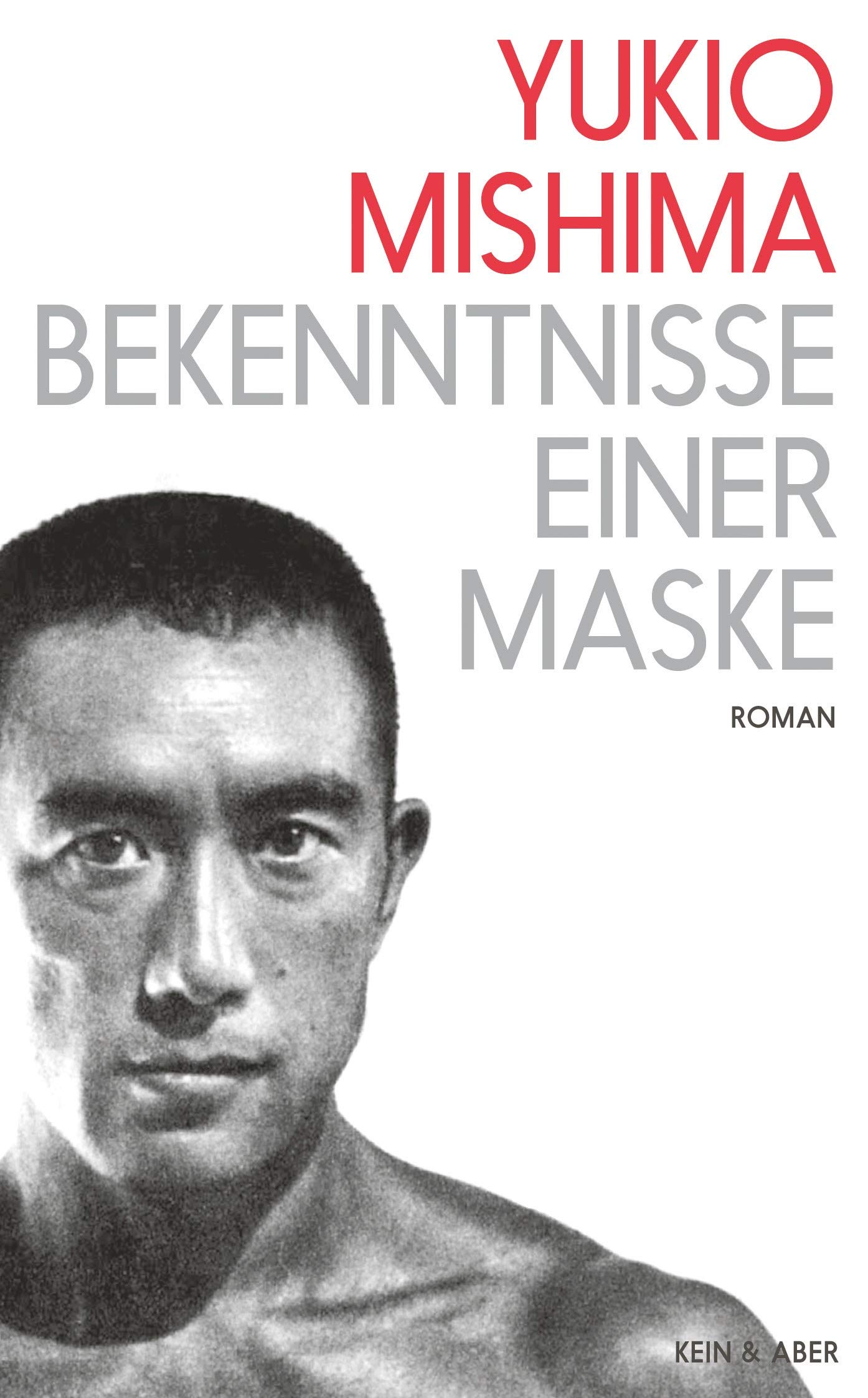



0 Kommentare zu “Buchtipp: „Bekenntnisse einer Maske“ – Yukio Mishima”